Den Menschen mitnehmen
Ein Gespräch mit Prof. Dr. Gudela Grote zur «digitalen Arbeitswelt»
Auch in den Versorgungsbranchen verändert sich die Arbeitswelt. Die Geschwindigkeit nimmt zu, es gilt, immer strengere Gesetze und Auflagen einzuhalten. Neue Technologien sollen vieles möglich machen, das lange undenkbar schien. Ein Zauberwort dabei heisst ‹Digitalisierung›. Führt sie zukünftig den Menschen? Oder ersetzt sie ihn gar? Wie kann eine gute Entwicklung gelingen? Wir konnten mit Frau Prof. Dr. Gudela Grote, ordentliche Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie im Departement ‹Management, Technology, and Economics› an der ETH in Zürich, über ihre Einschätzung sprechen.
Frau Prof. Grote, wie digital ist denn unsere Welt seit Neuestem tatsächlich?

(Schmunzelt) Wir ‹digitalisieren› ja schon lange, das ist doch ein kontinuierlicher Prozess. Piloten fliegen mit Autopilot, Prozessautomatisierung gibt es seit Jahrzehnten. Neu ist vielleicht, dass wir inzwischen versuchen, auch kognitive, bisher dem Menschen vorbehaltene Prozesse vollautomatisch abzubilden. Das führt zur Debatte um Künstliche Intelligenz (KI), und zur Frage, ob denn die Maschinen nun tatsächlich klüger sind als wir. Oder dazu, dass selbst die Entwickler nicht mehr genau wissen, was die Maschinen eigentlich machen, weil sie selbstgesteuert irgendwas lernen, man aber nicht genau weiss, was sie gelernt haben und wie und weshalb sie das gelernt haben. Das macht Angst.
In der Realität sieht das aber bisher weit weniger dramatisch aus. Es gibt in der Arbeitswelt nach wie vor mehr Anekdoten und Pläne als tatsächliche Anwendungen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass Künstliche Intelligenz in vielen Bereichen Einzug gehalten hat, die uns gar nicht bewusst sind. Nehmen wir das Beispiel der Spracherkennung: Jedes moderne Smartphone kann das zumindest ein bisschen. Da steckt viel KI dahinter. Wir sollten uns wohl derzeit weniger als Beschäftigte, sondern eher als Privatpersonen Gedanken über unseren Umgang mit Digitalisierung machen. Dazu gehört auch, uns bewusst zu machen, wo wir überall KI begegnen, und mehr darüber zu lernen.
Viele merken an, dass mit der Digitalisierung viel Fachwissen verloren ginge. Man beschäftige sich nicht mehr mit dem Prozess und verliere die Zusammenhänge, weil ja ‹die Maschine› steuert. Stimmt das?
Diese Frage wird schon lange diskutiert, besonders im Hinblick auf Erfahrungswissen, das nicht aus Büchern gelernt, sondern nur im direkten Umgang mit einer Aufgabe erworben werden kann. Man sollte aber auch überlegen, ob der Mensch nicht neue Arten von Erfahrungswissen erwirbt, auf einer abstrakteren Ebene – in der Aktion mit dem System anstelle mit dem realen manuellen Prozess.
Klar ist, je vernetzter Prozesse sind, umso schwieriger wird es, alles darüber zu wissen. Und natürlich sollte der Mensch möglichst gut verstehen, was er tut. Aber im Laufe technologischer Entwicklungen muss man immer wieder neu definieren, welche Art von Wissen nötig ist.
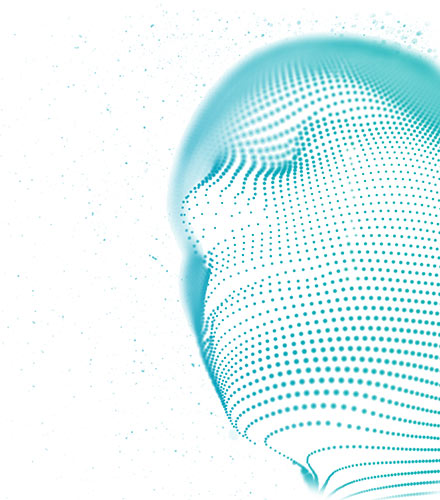
«Veränderungen werden besser und Technologieentwicklung nützlicher, wenn die betroffenen Menschen in Entscheide einbezogen werden.»
Mit der Digitalisierung der Prozesse wird auch immer wieder die Frage der Verantwortung gestellt: Mensch oder Maschine? Wie lässt sich das einordnen?
Da gibt es das viel diskutierte Beispiel der selbstfahrenden Autos: Haben die noch ein Steuerrad oder nicht? Solange ich das noch habe, dann ist die Verantwortung geklärt. Was, wenn das wegfällt? Und das wäre ja genau das Ziel, sonst brauche ich doch kein selbstfahrendes Auto (schmunzelt). Nur: Wenn kein Steuerrad mehr da ist, dann kann ich definitiv nicht mehr eingreifen und auch nicht die Verantwortung tragen. Wer dann? Die Betreiber der Autoflotte? Der Fahrzeughersteller? Gar der Entwickler, der die Software geschrieben hat?
Bei vernetzten Systemen, in denen mehrere Parteien gleichzeitig Einblick in die Prozessdaten haben, kann man leicht die Verantwortung hin- und herschieben. In solchen Fällen gibt es bislang die starke Tendenz, diese doch am ehesten bei den Menschen im operativen Prozess zu verorten, auch wenn diese eigentlich keine Eingriffsmöglichkeiten haben. Bei den Diskussionen ums autonome Fahren zeigt sich aber doch auch, dass die Einsicht wächst, dass Hersteller und Betreiber von Technologie mehr zur Verantwortung gezogen werden sollten.
Oft scheitert die Einführung neuer Technologien an der fehlenden Akzeptanz? Wie gelingt das (besser)?
Diese Frage beschäftigt die Human-Factors-Forschung immer wieder. Gute Ansätze bleiben jedoch meist auf die Gestaltung des Human Interface beschränkt, also die Bedienebene. Das ist wichtig, aber eben nicht alles. Bei Technologien, die direkt vom Endbenutzer beschafft und verwendet werden, gibt es eine direkte Rückmeldung: Wenn das Produkt nicht gut gemacht ist, dann wird es nicht gekauft. Bei Technologien, die in Arbeitsprozessen eingesetzt werden, fehlt diese direkte Rückkopplung. Die Organisation kauft das System, weil man ihr damit beispielsweise Produktivitätsgewinne versprochen hat. Und das glauben sie dann. Nur: Es sind die Menschen vor Ort, die das irgendwie hinbekommen müssen. Die im Zweifelsfall sogar noch schuld sind, dass keine Verbesserung gelingt, der Prozess eher langsamer geht, und mehr kostet.
Es braucht also mehr Miteinander?
Ja, absolut. Natürlich gibt es Überlegungen zur partizipativen Systemgestaltung schon lange. Aber auch bei bestem Willen ist das nicht so einfach umzusetzen, da wir ja oft gar nicht so genau wissen, was möglich ist und was uns letztendlich bei unserer Arbeit hilft. Trotzdem ist es ein Grundprinzip, die Menschen, die von Veränderungen oder Technologieentwicklungen betroffen sind, in solche Entscheide einzubeziehen. Und ebenso, genau hinzuschauen, nicht einfach Technologie von der Stange um des Automatisierens Willen zu kaufen.
Selbstverständlich ist auch Lern- und Veränderungsbereitschaft der Mitarbeitenden notwendig. Und sicher hat das viel mit dem einzelnen Menschen zu tun. Aber eben auch mit dessen ‹Geschichte› im Unternehmen. Durfte er dort bislang lernen? Oder hatte er immer nur Arbeiten zu leisten, bei denen man ihm genau sagte, was und wie er es zu tun hat? Plötzlich soll er lernen, soll Dinge selbst entscheiden. Das kann nicht so einfach gelingen. Entscheidend ist auch der Zeithorizont der Veränderung, wenn man die Menschen mitnehmen will. Wenn man sie möglicherweise umschulen muss, oder sich sogar ganz neue Berufsprofile bilden. Das sollte man früh genug erkennen, und dann auch entsprechend losmarschieren. Frage also: Nehme ich mir die Zeit für Veränderung?

«Nur weil etwas ‹flexibel› ist, ist es noch lange nicht für alle gut.»
Wir reden von Flexibilisierung der Arbeit, Remote-Working, Home-Office. Arbeiten, wo wir wollen und wann wir wollen, dem Internet sei Dank. Was gilt es zu beachten, damit das nicht aus den Fugen gerät?
Wichtig ist vor allem, dass man die Grenzen definiert. Nur weil etwas ‹flexibel› ist, ist es noch lange nicht für alle gut. Eine unbedingte Voraussetzung ist, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmende ihre Erwartungen im Arbeitsprozess möglichst explizit machen. Es muss konkret beschrieben sein, wie man mit den flexiblen Arbeitsformen umzugehen gedenkt, und daraus abgeleitet werden, wie die verschiedenen Interessen zusammengebracht werden können. Sprich: Man muss sich das genauer anschauen, wer welche Flexibilität wozu erwartet, z.B. Arbeit auch am Wochenende oder Privates während der regulären Arbeitszeit erledigen. Und dann die Frage beantworten, ob das zusammenpasst oder eben nicht.
Aufgabenstellungen werden komplexer, Gesetze und Verordnungen werden dichter, die Verantwortung nimmt zu. Damit steigt auch die Belastung der Menschen. Überforderung und Stress drohen. Was können Unternehmen tun, um ihre Organisation und damit ihre Mitarbeitenden zu stärken?
Hier kann man vor allem von zwei Merkmalen der sogenannten High Reliability Organizations (‹Hochzuverlässigkeitsorganisationen›) lernen. Das eine ist die Achtsamkeit der Führungskräfte und letztlich aller Beteiligten für betriebliche Abläufe (‹Sensitivity to operations›). Das geht natürlich nur vor Ort, man muss genau hinschauen – und Probleme sehen wollen. Und, das ist das Zweite, man muss sich mit den Problemen beschäftigen (‹Preoccupations with failure›). Das versetzt Organisationen in die Lage, Krisen und Störereignisse früher zu erkennen und ihnen zielgerichteter zu begegnen.
Dazu gehört auch Arbeitskollegen zusammenbringen, den Austausch zu fördern. Und eine Kultur pflegen, in der man sagen darf, dass man sich nicht in der Lage fühlt, eine Aufgabe zu erfüllen. Sei dies physisch oder psychisch, analog den Piloten, die sagen dürfen ‹I am not fit to fly›, und es dann auch nicht tun. Oder in Bezug auf die Qualifikation für eine Aufgabe. Kurz: Kann ich mich trauen zu sagen, dass ich Hilfe brauche, ich unsicher oder mit dieser Situation überfordert bin. Wenn ein solches Verhalten akzeptiert und im Unternehmen etabliert ist, dann hilft das enorm.
Und dann kann dabei Technologie auch von Vorteil sein: Anstelle mutterseelenallein etwas entscheiden zu müssen, kann ich beispielsweise noch jemanden weiteren – digital, von einem ganz anderen Ort aus – auf den Prozess schauen lassen. Aber eben: Das ist eine Frage der Organisationskultur. Gibt es ein Miteinander oder fühlen sich Mitarbeitende allein gelassen mit ihren Aufgaben.
Zusammengefasst: Heisst Technologieveränderung also mitunter auch Organisationsveränderung?
Ja, immer. Man muss aber genauer hinschauen, was oder wer wen beeinflusst. Müssen wir uns und unsere Organisation der Technologie anpassen, oder sollte es nicht umgekehrt sein? Digitalisierung um der Digitalisierung Willen kann kaum das Ziel sein. Deshalb müssen wir uns fragen, welche Optionen die technologische Innovation beinhaltet. Und dann schauen, ob sich damit Arbeitsprozesse verbessern lassen, ob wirtschaftliche Vorteile entstehen, und wie uns Technologie von unattraktiven oder gefährlichen Routineaufgaben entlasten kann. Eine kluge Antwort darauf lässt sich nur in direktem Dialog von Forschern, Entwicklern und Anwendern finden.
Aber es braucht auch den Dialog in den Unternehmen. Vieles funktioniert doch nur deshalb, weil Menschen unglaublich gutwillig sind. Weil sie sich mit ihrer Arbeit identifizieren, weil sie etwas Gutes machen wollen. Sie geben sich enorme Mühe, Dinge zum Laufen zu bringen und am Laufen zu halten. Fehlentscheide, beispielsweise bei der Technologieauswahl, werden deshalb oft in den Führungsetagen gar nicht als solche wahrgenommen.
In wichtige Entscheidungen sollten deshalb die Betroffenen immer einbezogen werden und Technologie nicht als Selbstläufer, sondern als in Richtung einer gemeinsamen Vision gestaltbar verstanden werden. Dann ist die Digitalisierung keine Bedrohung mehr, sondern kann positiver Treiber des Fortschritts sein.
Frau Prof. Grote, herzlichen Dank für das Gespräch.
Bildnachweis: iStock/a-r-t-i-s-t, iStock/maxkabakov
Kategorien
Experteninterviews
Bereiche
Wasserkraft
Wasserversorgung
Stromversorgung
Gasversorgung
Wärmeversorgung








